Vortragsmanuskript der Rede von Lennard Schmidt am 7. September 2025 auf der „Mahnwache gegen Antisemitismus“ in Berlin
Mein Name ist Lennard Schmidt. Ich spreche heute als Forscher und als Mitarbeiter der Initiative Interdisziplinäre Antisemitismusforschung (IIA) in Trier – einem Zusammenschluss junger Wissenschaftler:innen, die sich nicht damit zufriedengeben, Antisemitismus bloß zu beschreiben. Wir wollen ihn bekämpfen.
Oft begegnet uns Skepsis: Warum braucht es überhaupt Antisemitismusforscher:innen? Schreiben die nicht nur kluge Bücher, die im Regal verstauben und ohnehin nur von den Überzeugten gelesen werden?
Diese Frage ist berechtigt.
Denn die Antisemitismusforschung hat – mit wenigen Ausnahmen – in den vergangenen Jahren tatsächlich versagt. Sie hat sich zu oft weggeduckt, sich treiben oder vereinnahmen lassen. Statt ein Stachel in der deutschen Debattenlandschaft zu sein, war sie allzu häufig ein Papiertiger: zu leise, zu angepasst, zu bequem.

Der zunehmenden Sagbarkeit antisemitischer Narrative in Schulen, Theatern, Moscheen, Redaktionen und Verwaltungen hat sie selten etwas entgegengesetzt. Und an keiner Stelle wurde dieses Versagen so sichtbar wie nach dem 7. Oktober 2023.
Die Bilder dieses Tages waren so grauenvoll, dass sie die Welt in ein Davor und ein Danach geteilt haben. Ich wünschte, kein Mensch hätte sie je sehen müssen. Doch sie zwingen jeden denkenden und fühlenden Menschen zu einer Entscheidung:
Weitermachen wie bisher – oder anerkennen, dass die alten Routinen nicht mehr tragen?
Viele haben sich für das Weitermachen entschieden. Nach dem größten Massenmord an Jüdinnen und Juden seit der Shoah folgten Phrasen, Gremiensitzungen und Konferenzkalender. Es dauerte keine Woche, bis die üblichen Stimmen dem einzigen jüdischen Staat wieder sein Jüdischsein zum Vorwurf machten.
Wer also sagt, die Antisemitismusforschung habe versagt, hat recht. Aber das spricht nicht gegen die Forschung – sondern gegen eine Forschung, die ihren eigenen Anspruch vergessen hat.
Denn es gab auch andere: Menschen, die Haltung zeigten, ohne feste Stellen, ohne große Fördermittel, ohne institutionellen Rückhalt. Forscher:innen, die dem Druck ihrer Kolleg:innen standhielten, die nicht wegsahen, sondern analysierten, verstanden, kontextualisierten. Sie bauten die Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart. Sie wussten: Erinnerung ist notwendig – aber sie allein genügt nicht. Oder, wie Walter Benjamin schrieb: Wir schulden den Toten eine Zukunft.
Diese Forscher:innen gefielen sich nicht in der Pose des überlegenen Intellektuellen. Sie wussten: Klugheit schützt nicht vor Antisemitismus. Aufklärung macht niemanden immun. Im Gegenteil: Die erste Berufsgruppe, die den Nationalsozialisten verfiel, waren Professor:innen. Und auch heute sind es wieder Akademiker:innen, die jüdischen und israelischen Kolleg:innen nach dem 7. Oktober das Leben schwer machen – an Universitäten, auf Bühnen, in Gremien.
Diese antisemitismuskritischen Forscher:innen haben angesichts dessen verstanden: Der 7. Oktober hat neue antisemitische Allianzen hervorgebracht. Die neue Achse des Antisemitismus verläuft längst nicht mehr entlang alter Linien – wenn sie das überhaupt je tat. Gerade in vermeintlich progressiven Milieus fehlt es an Empathie für Jüdinnen und Juden. Dort gratuliert man sich in offenen Briefen gegenseitig zur eigenen moralischen Überlegenheit – und schweigt, wenn jüdische Stimmen am dringendsten gehört werden müssten. Diese Menschen suchten den Antisemitismus stets nur beim politischen Gegner.
Wer ihn aber wirklich verstehen will, muss dorthin schauen, wo es wehtut: ins eigene Umfeld, in die eigene Partei, in den eigenen Freundeskreis. Unbequem zu sein – auch gegen sich selbst –, das ist die Aufgabe einer Antisemitismusforschung, die diesen Namen verdient.
Antisemitismus ist kein individuelles Ressentiment, sondern ein strukturelles Phänomen. Er speist sich aus politischen Ordnungen, ökonomischen Krisen und kulturellen Deutungsmustern. Über Antisemitismus zu forschen, heißt, diese Strukturen zu kritisieren – mit dem Ziel, sie zu verändern. Denn die ersten Antisemitismusanalysen kamen von jüdischen Wissenschaftler:innen, die wussten: Forschung darf niemals Selbstzweck sein.
Wer über Antisemitismus forscht, tut das niemals neutral. Das Ziel jeder Forschung muss die Abschaffung des Antisemitismus sein.
Und wer das nicht ins Zentrum seiner Arbeit stellt, wer Antisemitismus behandelt wie die Geschichte der Kartoffelzucht – oder wer die Lage nutzt, um im Windschatten Karriere zu machen oder unter dem Deckmantel der Wissenschaft Israel zu delegitimieren – der verrät den Anspruch, der in die DNA der Antisemitismusforschung eingeschrieben ist.
Darum fordere ich: Die Antisemitismusforschung muss endlich den Mut aufbringen, ihren eigenen Anspruch ernst zu nehmen. Sie muss Seismograph der beschädigten Welt sein, Chronistin des Versagens und Advokatin derer, die keine Stimme haben. Sie darf nicht feige sein, niemals bequem. Ihre Aufgabe ist: Verstehen, um zu verändern. Alles andere ist Feigheit oder Selbstbeschäftigung.
Nachtrag: Ein Angriff im Rheinland
Gestern Abend1 sprach ich beim Bündnis gegen Antisemitismus Rheinland. Auf der Fahrt von Trier nach Berlin heute – sie dauerte zehn Stunden – erhielt ich Anrufe: Das Bündnis war nach der Veranstaltung Opfer eines antisemitischen Übergriffs geworden. Vier vermummte, bewaffnete Jugendliche mit Kufiya versuchten, die Veranstalter:innen einzuschüchtern, während sie gerade abbauten.
Das zwingt mich zu einem letzten Gedanken:
In den letzten Monaten sind überall selbsternannte „Expert:innen“ für Antisemitismus aufgetaucht. Sie erklären mit großem Gestus, wie gefährlich, irrational und genozidal Antisemitismus sei – aber sie glauben es nicht wirklich.
Sie glauben nicht, dass der nette Antifa-Genosse im Ernstfall zuschlägt. Sie glauben nicht, dass der Nachbar, der samstags den Rasen mäht, im Extremfall jemanden krankenhausprügelt, weil er ihn für einen „zionistischen Agenten“ hält.
Und sie glauben es nicht, weil sie im entscheidenden Moment immer zurückschrecken. Wenn Polizei, Politik oder Justiz tatsächlich handeln könnten – passiert nichts. Stattdessen wird beschwichtigt. Doch genau das hieße, die neue Realität anzuerkennen.
Expert:in sein heißt, diese Realität ernst zu nehmen – und nicht zu beschwichtigen.
Vielen Dank.
Beitragsfoto
Kamil Majchrzak (Mahnwachen gegen Antisemitismus)
Fußnoten
- Am 6. September 2025 [Anm. d. Red.]. ↩︎
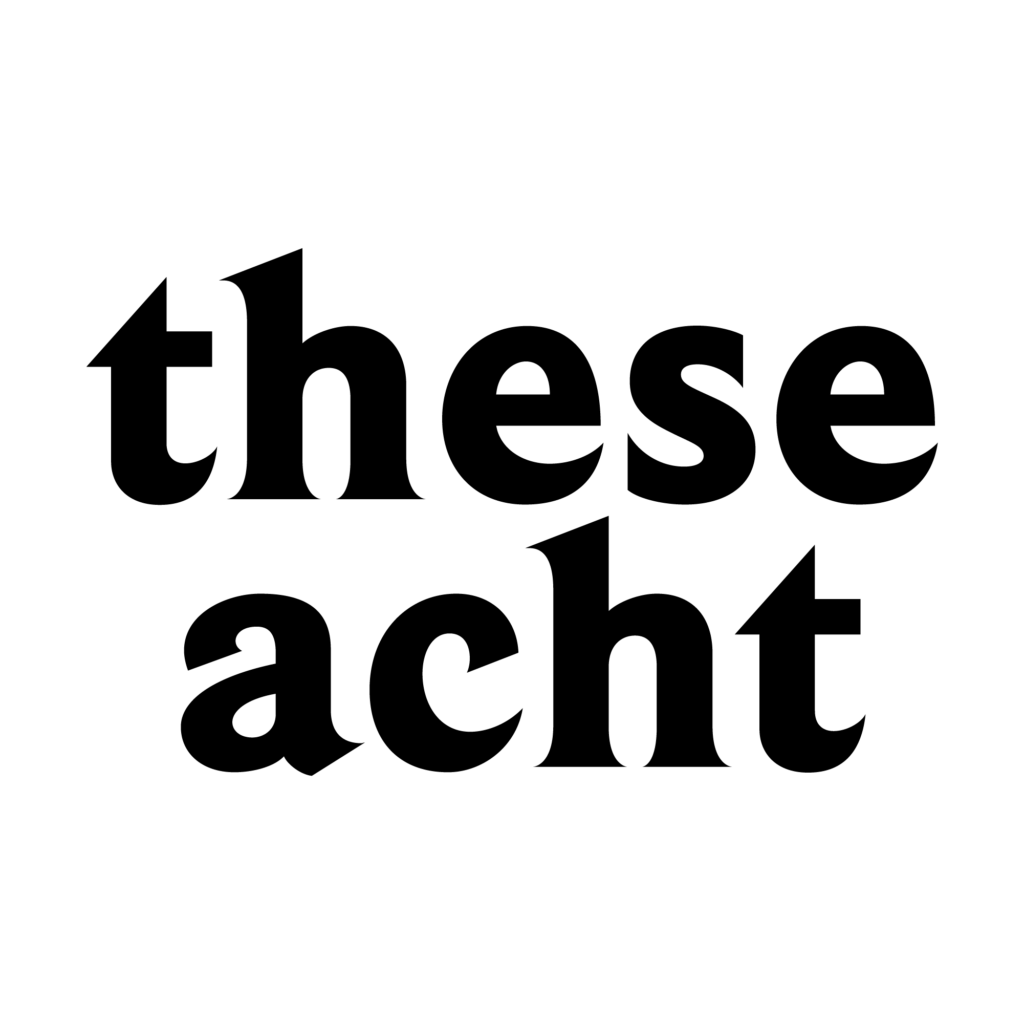

Schreibe einen Kommentar